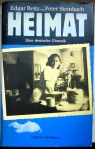Im letzten Jahr hatte ich angefangen, ein paar kleinere Geschichten aufzuschreiben. Einige sind fertig, andere noch nicht. Wahr sind sie alle, denn ich kann mir nichts ausdenken. Gerne hätte ich sie in einem kleinen Buch versammelt gesehen, konnte den Verlag aber nicht überzeugen. Das ist nicht so tragisch, es gibt ohnehin zu viele Bücher. Da ich keine Lust habe, bei anderen Verlagen anzuklopfen, werde ich hier gelegentlich die eine oder andere Geschichte veröffentlichen. Und immerhin eine dieser Geschichten wird in diesem Buch veröffentlicht, dass im Mai 2020 erscheinen soll.
Das Vorstellungsgespräch
Das Gespräch, das mein Leben veränderte, dauerte etwa eine Viertelstunde. Ich saß lediglich dabei als ginge mich das alles nichts an und hörte zu, wie sich zwei Männer über mich unterhielten. Nur gelegentlich gab ich einen Kommentar ab.
Am Morgen war ich in Berlin am Bahnhof Zoo in einen ICE gestiegen, der mich nach Frankfurt am Main brachte. Dort fuhr ich mit der U-Bahn ins Westend, fragte mich zur Lindenstraße durch und meldete mich am Empfang des Suhrkamp Verlages. Ich möge einen Moment Platz nehmen, gleich würde mich jemand abholen. Auf dem schwarzen Uwe-Johnson-Sofa im Eingangsbereich wartete ich ein- zwei Minuten, bis mich mein künftiger Abteilungsleiter und Vorgesetzter begrüßte. Der Aufzug brachte uns in den dritten Stock. Ich war zum Vorstellungsgespräch beim damaligen kaufmännischen Geschäftsführers des Verlags geladen. Für diesen Anlass hatte ich mir den ersten Anzug meines Lebens gekauft. Nun saß ich da in meinem Anzug und wartete darauf, dass das Vorstellungsgespräch beginnen würde und ich ein paar Fragen beantworten müsste. Das blieb aus. Was der Abteilungsleiter über mich berichtet hatte, schien dem Geschäftsführer zu genügen. Nach fünfzehn Minuten durfte ich wieder gehen, mein künftiger Chef versprach, sich zu melden. Ich fuhr zurück zum Bahnhof. Am Tresen der DB-Lounge vertrieb ich mir die Zeit bis zur Abfahrt meines Zuges. Gegen 17 Uhr, ich trank mein zweites Bier, klingelt das Telefon. Ich hätte den Job, in den nächsten Tagen würde man mir den Arbeitsvertrag zuschicken, ich möge bitte am 10. Januar anfangen. Vierundzwanzig Jahre Berlin näherten sich dem Ende. In sechs Wochen musste ich umziehen. Der Kreis schließe sich, bemerkte mein Vater, ein gebürtiger Frankfurter, als ich anrief und die Neuigkeit verkündete.
Im Zug
Während mich der ICE zurück zum Bahnhof Zoo brachte, schaute ich aus dem Fenster und versuchte, mir mein künftiges Leben in „Westdeutschland“ vorzustellen. Ich kannte Frankfurt, hatte als Kind mit meinen Eltern schon einige Jahre in der Stadt gelebt und war in Sachsenhausen zur Schule gegangen. Zudem fuhr ich jährlich zur Buchmesse. Frankfurt war mir sympathisch, schön fand ich es nicht. Die Vorstellung, dort zu leben, fiel mir jedoch schwer. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass jemand freiwillig nach Frankfurt zog, etwa weil die Stadt so attraktiv ist, oder wegen des kulturellen Angebots und des hohen Freizeitwerts. Da ging man doch eher nach Berlin, Hamburg oder München. Frankfurt zählte für mich eher zu den grauen Mäusen unter den deutschen Städten, kurz vor Stuttgart und Hannover. Sicher, am Main ist es ganz schön, er wurde von der Stadt aber eher stiefmütterlich behandelt. Aber was ist der Main gegen die Wasserlandschaft Berlins mit Havel, Spree, Landwehrkanal und all den Seen? Und die Skyline war ganz hübsch anzusehen, Leben ging von diesen Gebäuden allerdings nicht aus. Wer nach Frankfurt zog, tat das eines Jobs oder vielleicht noch der Liebe wegen, nie jedoch aus freien Stücken. Dennoch, Apfelwein kannte und mochte ich und Fan der Eintracht war ich seit frühester Kindheit. Die Lage der Stadt und die Möglichkeit sehr schnell in alle Richtungen verschwinden zu können, schien mir ihr größter Vorteil zu sein. Ich fühlte mich als Berliner durch und durch, war jedoch bereit für Neues. Kurz zuvor hatte sich die lang umworbene Kölner Journalistin nach nur wenigen Monaten wieder von mir verabschiedet, und somit in einen Zustand versetzt, der wohl gemeinhin als Midlifecrisis bezeichnet wird. Bislang dachte ich immer, dieser Zustand sei eine Schimäre, aber jetzt hatte sie mich ordentlich im Griff und die Bereitschaft wachsen lassen, mein Leben zu ändern. Der Mauerfall hatte auch die Buchhandlung, in der ich elf Jahre gearbeitet hatte, in Schieflage gebracht. Längst war sie nicht mehr das erste Haus am Platze. Neue Konkurrenz hatte sich angesiedelt, die wirtschaftliche Situation der einst größten Buchhandlung Deutschlands verschlechterte sich zusehends. Mit Abfindungen sollten so viele wie möglich der ehemals einhundertvierzig Beschäftigten bewegt werden, freiwillig die Firma zu verlassen. Das traf sich gut mit meinem neuen Job bei Suhrkamp.
Die Stammkneipe
Am Abend wieder in Kreuzberg, steuerte ich umgehend meine Stammkneipe an. Sie lag auf dem Weg am Chamissoplatz, nur wenige Meter von dem Haus entfernt, in dem ich lebte. „Hansi“, sagte ich zum Wirt, „ich ziehe nach Frankfurt. Habe einen Job bei Suhrkamp, den konnte ich nicht ablehnen. In sechs Wochen bin ich weg.“ Hansi bedauerte das natürlich, beglückwünschte mich trotzdem, bemerkte aber, dass ich so einen Laden wie das Matto, so hieß die Kneipe, in Frankfurt wohl nur schwer finden würde. Er sollte recht behalten, zumindest für einige Jahre. Der letzte Tag des 20. Jahrhunderts war mein letzter Arbeitstag in Berlin.
Die ersten Monate
Zunächst kam ich bei Freunden in Offenbach unter, die ich aus gemeinsamen Berliner Tagen kannte. Ihr Gästezimmer diente mir für die ersten drei Monate als Unterkunft. Durch eine Suchanzeige in der Frankfurter Rundschau fand ich eine Wohnung in der Seckbacher Landstraße. Bornheim, so hieß es, sei ein begehrter Bezirk. Die Wohnung sagte mir zu. Ein Altbau, Parkettfußboden, Einbauküche, bezahlbar. Sie hatte die richtige Größe für mich und war ähnlich geschnitten wie meine Kreuzberger Wohnung. Der private Vermieter machte einen sympathischen Eindruck. Und doch hätte ich unter anderen Umständen diese Wohnung nicht genommen. Sie lag im ersten Stock an der Seckbacher Landstraße, einer stark befahrenen Ausfallstraße mit Busverkehr und ständigem Sirenengeheul der Rettungswagen, die Tag und Nacht das Bethanien- oder Katharinen-Krankenhaus ansteuerten. Das Rattern der U4, die unter dem Haus verkehrte, brummte durchs Haus und ließ es leicht vibrieren. An Schlaf bei offenem Fenster war nicht zu denken. Dennoch, ich brauchte eine Wohnung. An den Lärm würde ich mich schon gewöhnen, sagte ich mir. Im April zog ich ein.
Jetzt war ich schon einige Monate in Frankfurt. Ich war eingerichtet, mit den ersten Kollegen per Du, ich wusste auf welchen Wegen ich am bequemsten mit dem Rad von Bornheim ins Westend kam und wo ich einkaufen konnte. Eingelebt hatte ich mich nicht. Freundschaftliche Beziehungen zu meinen neuen Kolleginnen und Kollegen bauten sich nur zögerlich auf. Nach wie vor kannte ich nur meine alten Freunde aus Berliner Zeiten sowie einen ehemaligen Schulfreund, der in Frankfurt arbeitete und ebenfalls in Offenbach wohnte. Ich hatte in meiner Umgebung ein kleines Spanisches Lokal entdeckt, das uns zusagte. Bei José trafen wir uns wöchentlich, gelegentlich auch in Offenbach. Auf der Suche nach einer Wirtschaft, die als Stammkneipe geeignet war, besuchte ich diverse Wirtshäuser in der näheren Umgebung. Ich brauchte ein Matto. Aber ich wurde nicht fündig, keins der Lokale entsprach meinen Vorstellungen. Eine Apfelweinwirtschaft zu meiner Stammkneipe zu machen, wäre doch ein zu großer Schritt gewesen, quasi ein Kulturschock. Dem Thema musste man sich behutsam nähern. Ich verbrachte also die meisten meiner Abende zuhause, es sei denn die Offenbacher riefen. Eine Stammkneipe musste her. Aber was macht eine Kneipe zu einer Stammkneipe?
So eine Wirtschaft muss fußläufig in wenigen Minuten erreichbar sein. Das Matto war ideal, ich schaute aus dem Fenster und konnte zumindest im Sommer sehen, ob jemand draußen saß, den ich kannte. Meistens war das so. Und wenn ich niemanden kannte, war da immerhin Hansi, der Wirt, der stets ein offenes Ohr hatte. Die Einrichtung muss passen, Tischdecken und anderes Gedöns brauchte ich nicht. Ich suchte eine Kneipe, kein Restaurant. Das Angebot muss stimmen, gutes Bier, gutes Essen zu guten Preisen und natürlich ein gutes Publikum. Wenn schon Musik im Hintergrund läuft, muss mir diese gefallen. Und, ganz wichtig, der Wirt oder die Wirtsleute müssen sympathisch sein. Das ist vielleicht das Wichtigste. Dort will man sich wohlfühlen und auch mal, in Zeiten monetären Mangels, einen Deckel machen können. Zu diesem Wohlfühlen tragen der Wirt oder die Wirtin entscheidend bei, sie halten eine Kneipe zusammen.
Zwischen Berlin und Frankfurt
Meine Wohnung am Kreuzberger Chamissoplatz hatte ich behalten, sie war preiswert. In den ersten Monaten fuhr ich alle vierzehn Tage übers Wochenende nach Berlin und ging unter anderem ins Matto. Und da gab es noch meinen Lieblingsitaliener, Zagato, in der Bergmannstraße, gegenüber der Markthalle. Benannt war der Laden nach dem Konstrukteur der Alfa-Romeo-Sportwagen. Photos dieser Autos zierten dann auch die Wände des Lokals. Daneben Bilder von Rennmotorrädern, Inter Mailand und Radrennfahrern, Fausto Coppi und anderen. Die Decke tapeziert mit italienischen Sportzeitungen, die an die Triumphe des italienischen Fußballs erinnerten. Der Rest der Einrichtung war schlicht gehalten, Papiertischdecken, einfache Weingläser, keine aufgetürmten Servietten. Im nur selten genutzten Nebenraum stand ein altes Motorrad. Auf dem Heizkörper unter der großen Fensterfront ein Zettel: Füße runter von der Heizung, ZAKI ZAKI! An der Wand befahl ein weiterer Hinweis: Keine Zigarren! ZAKI ZAKI! Im Hintergrund erklang dezent italienische Schlagermusik der Fünfziger Jahre. Ein kleiner Raum, sieben Tische. Im Sommer zusätzlich fünf vor der Tür. Die Speisekarte änderte sich nie, Pizza suchte man vergebens. Gelegentlich gab es ein bis zwei wechselnde Tagesgerichte. Alles schmeckte köstlich. Die Weinkarte war überschaubar. Hier gab es von nichts zuviel, selbst die gespielte und übertriebene Freundlichkeit manch italienischer Kellnerdarsteller mit einem geträllerten Buona Sera Dottore und Ciao Bella hatte hier keinen Platz. Die Gäste wurden mit der gebotenen Zurückhaltung sehr freundlich begrüßt, bedient und verabschiedet, Smalltalk über Fußball und das eigene Befinden in angemessener Dosierung. Zum Abschluss gab`s einen Grappa aufs Haus. Zagato war ein Familienbetrieb, der Vater stand in der Küche, der Sohn, Mario, kümmerte sich um den Service. Das machten sie seit vielen Jahren so, täglich bis auf Sonntag. Mario war Eintrachtfan. Die Trikots erinnerten ihn an die von Inter Mailand. Wenn ich von Frankfurt aus anrief, um zu reservieren, lag dann auf dem jeweiligen Tisch ein Zettel, auf dem stand „Eintracht Stefan“. Als ich einige Jahre später bei einem weiteren Berlinbesuch mit einem befreundeten Buchhändler ins Zagato wollte, sagte dieser, der Laden sei zu, sie hätten vor einer hundertprozentigen Mieterhöhung kapituliert. Ich war geschockt und fühlte mich heimatlos. Nach einem solchen italienischen Lokal habe ich in Frankfurt bislang vergebens gesucht. In Berlin dann auch.
Sonntags kam der unausweichliche Zeitpunkt der Rückreise. Nach einem letzten Blick aus dem Fenster verließ ich wehmütig mein Gründerzeitviertel und stieg am Platz der Luftbrücke in die U-Bahn, die mich zum Hauptbahnhof brachte. Aus dem ICE heraus beobachtete ich wie mir Berlin unaufhaltsam entglitt. Vier Stunden später stieg ich fast vor meiner Haustür aus dem Schacht und fand mich auf der Seckbacher Landstraße, verloren und am falschen Ort. Autos rauschten vorbei und Passanten eilten zur U-Bahn. Was hatte ich hier zu suchen? Ob es so eine gute Idee war, aus Berlin wegzugehen? Diese Frage stellte ich mir über Jahre.
Nach zwei Jahren lernte ich die Nichte einer Kollegin kennen. Sie arbeitete im Eichborn Verlag als Lektorin. Wir wurden ein Paar, bis wir anderthalb Jahre später übereinstimmend feststellten, dass die Beziehung ein Irrtum war und wir uns wieder trennten. Aber durch sie lernte ich andere Menschen und Orte kennen, und kam somit etwas mehr in Frankfurt an. Am schönsten war es aber immer, wenn wir zusammen in Berlin waren. Sie ging leidenschaftlich gerne ins Matto und mochte Hansi, den Wirt, sehr.
Das Klabunt
Nach etwa fünf Jahren, ich war immer noch nicht richtig in Frankfurt angekommen, geschah etwas, dessen Tragweite ich noch nicht absehen konnte. In der oberen Berger Straße eröffnete in einem kleinen Fachwerkhäuschen, das zuvor einen Thai-Imbiss beherbergt hatte, ein Lokal. Klabunt stand draußen dran, sowie Satire und Schnaps. Es war Sommer und auf dem Gehweg davor standen zahlreiche Biergarnituren. Das war einladend, aber ich brauchte einige Wochen, um dort erstmals einzukehren. Mit meinem alten Schulfreund, der immer noch in Offenbach wohnte, verabredete ich ein Treffen in eben jenem Lokal. Es war ein sonniger Tag und wir setzten uns nach draußen. Ein großer, schwarz gekleideter und bleichgesichtiger Mann bediente uns. Später stellte sich heraus, dass es der Wirt war. Die Speisekarte bot Ungewöhnliches auf hessischer Basis. Wir bestellten beide ein Frankfurter Schnitzel. Es war köstlich und reichhaltig. Wohlgesättigt verlangten wir zum Abschluss nach Wodka. Den gab`s nicht, dafür aber einen herrlichen Obstbrand aus heimischen Gefilden. Wir waren überzeugt. Fortan ging ich öfter ins Klabunt, auch alleine. Der Name war ein Wortspiel aus Klabund, dem satirischen Dichter der zwanziger Jahre und der hessischen Fassung von klein und bunt, klaa un bunt. Ich setzte mich an einen ovalen Tisch neben dem Tresen, trank anfangs dunkles Bier und las. Irgendwann kam ich ich mit den Wirtsleuten ins Gespräch und das Bier wurde mir ungefragt hingestellt. Zu Fuß brauchte ich von der Seckbacher Landstraße etwa zehn Minuten. Das Klabunt veränderte mein Leben. Ich hatte eine Stammkneipe, auch wieder mit einem literarischen Namen.
Die Kneipe gehörte zum Umfeld der Titanic. Davon zeugten zahlreiche Cartoons, die die Wände zierten. Regelmäßig wurden Lesungen, vorwiegend aus dem humoristischen Genre, veranstaltet. Namhafte Satiriker, Autorinnen und Autoren fanden den Weg in den „Satirelandgasthof“ Klabunt. Längst war ich Stammgast, kannte die anderen Stammgäste und organisierte selbst drei Lesungen mit Autoren des Suhrkamp Verlags.
Trotz aller kulinarischen Raffinesse ist das Klabunt eine Kneipe geblieben. Am langen Tresen traf man auch noch nachts um zwei irgendwelche bekannten Gesichter. Vieles von dem, was mein jetziges Leben in Frankfurt ausmacht, hat seinen Ursprung in diesem Wirtshaus.
Ein langer Abschied
Meine Wochenendfahrten nach Berlin wurden weniger. Trotzdem wäre ich noch immer sofort wieder zurückgegangen, wenn sich eine Gelegenheit ergeben hätte. Als der Verlag in einer herrschaftlichen zweihundert Quadratmeter großen Wohnung in der Berliner Fasanenstraße eine Repräsentanz eröffnete, erkundigte ich mich, ob geplant sei, dort ein Büro zu eröffnen. Dem war nicht so, ich blieb.
Es schien, als sei erst jetzt, nach etwa sieben Jahren der Moment gekommen, mich endgültig in Frankfurt einzurichten. Meine Berlinfahrten wurden noch weniger. Im Jahr 2008 räumte ich die Wohnung in der Kopischstraße, in der ich seit 1985 gelebt hatte. Es war die schönste Wohnung, in der ich jemals gewohnt habe, in einer der schönsten Gegenden Berlins. Dennoch verließ ich sie ohne Wehmut. Für die endgültige Fahrt nach Frankfurt gönnte ich mir ein 1.Klasse Ticket. Good Bye Berlin.
Der Umzug
An einem Vormittag im Februar 2009 wurden den Suhrkamp-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Umzug des Verlags nach Berlin im Januar 2010 verkündet. Das hatte niemanden mehr überrascht, Gerüchte gab es schon länger. Außerdem stand die Meldung bereits eine Viertelstunde vor der Versammlung im Internet. Es ging sehr lebhaft zu im Sitzungszimmer. Für den Rest des Tages wurde nicht mehr viel gearbeitet. Wäre die Entscheidung drei Jahre früher gefallen, ich wäre mit wehenden Fahnen zurück nach Berlin gezogen. Jetzt hingegen war ich auf dem besten Weg, Frankfurter zu werden. Aber es blieb noch fast ein Jahr Zeit, da würde mir noch irgendwas einfallen. Es gab ja noch andere Verlage in Frankfurt. Aber meine Versuche, woanders unterzukommen, scheiterten. Es wurde Dezember, ich brauchte eine Wohnung in Berlin. In Prenzlauer Berg wurde ich dank Internet fündig. Ich schickte einen Kollegen zur Besichtigung, besuchte an diesem Tag einen alten Freund in Stuttgart. Dem Kollegen sagte die Wohnung zu, die Bilder, die ich gesehen, hatten mir gefallen. Die Miete hielt sich auch im Rahmen. Ich bekam die Wohnung, wurde bevorzugt, weil ich bei Suhrkamp arbeitete. Es gab unzählige weitere Bewerber. Der Umzugstermin kam bedrohlich näher und mir wurde immer mulmiger zu Mute. Grundsätzlich entschied ich lieber selbst, wenn ich umziehe. Meine umzugsfreudigen Eltern haben mir in Kinderjahren mit ihren vielen Ortswechseln keine Freude gemacht.
In den Büros wurde geräumt und gepackt. Auf den letzten Drücker suchte ich nach einem Ausweg. Der bot sich durch die Kooperation mit einem kleinen Frankfurter Verlag und Regionaliaproduzenten. Dass das keine gute Idee war, ist eine andere Geschichte.
Am 10. Januar 2010, genau zehn Jahre nach meinem ersten Arbeitstag im Suhrkamp Verlag, schrieb ich meine Kündigung zu Ende Februar. Die Wohnung in Prenzlauer Berg sagte ich ab. Ich war angekommen im „Weltkaff“ (Eva Demski), ich war Frankfurter.