Ein Spaziergang
Wie immer donnerstags verlasse ich am frühen Nachmittag Schreibtisch und Laptop, ziehe bequeme Schuhe an und begebe mich auf einen Spaziergang in Richtung Innenstadt. Ein Ritual, das ich gelegentlich auch am Samstag wiederhole. „Schuhe schnüren, herumgehen, Kopf lüften“ teile ich der Welt via Twitter mit. An diesen beiden Tagen traue ich mich die Konstablerwache zu betreten, diesen Vorhof zur Hölle, auch Zeil genannt. Dann erwacht dieser Platz, diese innerstädtische Ödnis, zu turbulentem Leben. Ungezählte Menschen drängen sich unter den bunten Schirmen des Erzeugermarkts mit seinen verlockenden regionalen Angeboten. Kräuter, frisches Obst und Gemüse, Fisch, Fleisch, Geflügel, unzählige Wurst- und Käsesorten, Backwaren aus handwerklicher Produktion und in unübersichtlicher Vielfalt finden sich neben den eng belagerten Ständen mit Säften, Wein, Bier und selbstverständlich Apfelwein. Sie verweilen, kaufen ein, essen Bratwürste oder Handkäs, belagern die vielen Stehtische, trinken ihren Schoppen und sorgen für ein lebhaftes Stimmengewirr. Ganz Frankfurt ist dort anzutreffen, besonders samstags. Bei gutem Wetter kann es qualvoll eng sein. Dass an diesen Tagen die Konstablerwache mehr oder weniger unsichtbar wird, ist ein willkommener Nebeneffekt des geselligen Treibens. Wer Frankfurt kennenlernen will, sollte den Erzeugermarkt besuchen. Hier ist der Querschnitt der einheimischen Bevölkerung versammelt. Aber fangen wir oben an.
Die Berger Straße
Ich gehe die Berger Straße stadteinwärts, diese Einkaufs- und Vergnügungsstraße, die im ständigen Wandel begriffen ist. Moden und Trends hinterlassen auf der Berger stets ihre Spuren. Oft sind diese nach kurzer Zeit auch wieder passé. Gewachsene Traditionen sind dort kaum zu finden, sieht man mal von der alteingesessenen Apfelweinwirtschaft Solzer im oberen Abschnitt der Straße ab. Das ehrwürdige Wirtshaus Zur Sonne wurde verkauft. Nach Monaten der Ungewissheit hat es unlängst mit neuen Inhabern wieder geöffnet. Eine gute Nachricht. Das Gebäude des ehemaligen Elektrokaufhauses wurde komplett umgestaltet und mit einem anderen Angebot und unter anderem Namen neu eröffnet. Berger-Village haben sich die Marketingleute ausgedacht, vielleicht in Anlehnung an den Stadtteil, den etliche Frankfurter auch heute noch als das „Lustige Dorf“ bezeichnen. Das Aus für „Saturn-Hansa“ bedeutete auch das Aus für einige Einzelhändler, die vom Einzugsgebiet des Elektromarkts profitierten. Anderorts herrscht allerdings jahrelanger Stillstand. In der oberen Berger Straße bietet die Brache, an der einst die Kultgaststätte Klabunt beheimatet war, nun Insekten, Vögeln und anderem Getier eine willkommene Heimat. Das Klabunt musste weichen, weil dort ein „Quartiersparkhaus mit Einkaufsmarkt und Wohnungen“ entstehen sollte. Diese Pläne wurden mit dem Ableben des Investors Gaumer beerdigt. Mittlerweile ist zu lesen, dass im Jahr 2020 mit der Bebauung des Geländes begonnen werden soll.
Fußgänger habe es schwer auf der oberen, sehr engen Berger Straße. Die Gehwege sind schmal und der Autoverkehr, der sich durchzwängt, tut ein Übriges. Man fragt sich, weshalb dort überhaupt Autos fahren dürfen. Das ist aber nicht nur ein Problem der Berger Straße. Sind die Gehwege in Frankfurt mal breit genug, um zum Spazieren einzuladen, werden sie oft durch quer parkende Autos zugestellt.
Ich gehe weiter. In immer kürzer werdenden Abständen kauern Menschen auf dem Gehweg und halten den Passanten leere Pappbecher mit der Bitte um etwas Kleingeld hin. Meist werfe ich ein paar Münzen in eines der zerknitterten Behältnisse. Andere durchstöbern Mülleimer während missionarisch gesinnte Zeugen Jehovas erbauliche Schriften feilbielen. Wäre ich gläubig, würde ich Gott danken, gesunde Beine zu haben und unbeschwert gehen zu können. Ein Geschenk.
Bubble-Tea und andere Kuriositäten
Längst vorbei ist einer der kuriosesten Trends der letzten Jahre, der sich natürlich auch auf der Berger Straße manifestierte. Wie eine Seifenblase geplatzt ist der Bubble-Tea-Boom – und das macht ja ein wenig Hoffnung. Mittlerweile werden die Läden von Nagelstudios, Waffelbäckereien und anderen seltsamen Angeboten genutzt. So versucht seit Kurzem ein merkwürdiges Geschäft sein Glück. Geneigte Passanten können sich dort für drei Minuten auf minus 150 Grad Celsius abkühlen lassen, „ohne Schwitzen und ohne Duschen“. Angeblich soll das dazu führen, überflüssige Kalorien zu verbrennen. Ob das eine gute Geschäftsidee ist, wird sich zeigen. Kundschaft habe ich dort noch keine gesehen. Erfolgreicher ist allerdings ein anderer ungewöhnlicher Laden einige Meter weiter, in dem man „Schwarzlicht-Minigolf“ spielen kann. Die Bediensteten tragen neonbunte T-Shirts und haben gut zu tun. Ich bevorzuge jedoch Bewegung an der frischen Luft wie regelmäßiges Gehen, auch wenn ich dabei gelegentlich ins Schwitzen komme.
Südlich der Höhenstraße wird es vorwiegend gastronomisch. Das Angebot ist abwechslungsreich wenn auch oft nur kurzlebig. Fast schon im Wochenrythmus öffnen und schließen entsprechende Betriebe unterschiedlichster Ausrichtung. Vegetarische, vegane und Rohkost-Restaurants wechseln sich ab mit Currywurstbuden, Pizzerien, Ökobäckern, Cafés, Buchhandlungen, Steakhäusern, Burger-Bratereien und Weinhändlern. Ein neu eröffneter Laden, der sich auf Donuts spezialisiert hat, ist offensichtlich, und zu meiner Verwunderung, sehr erfolgreich. Regelmäßig belagern vorwiegend junge Leute in Dreierreihen den Laden und tragen mit glücklichen Gesichtern die süße Beute in bunten Kartons davon. Manche setzten sich auch an die Bänke vor dem Laden und vertilgen die klebrigen Zuckerkringel gleich vor Ort. Freitagabends lädt eine Buchhandlung mit dem pragmatischen Namen Buch & Wein zum „Betreuten Trinken“ in ein ehemaliges Fotostudio im Hinterhaus. Für den Spaziergänger also genügend Möglichkeiten, eine Pause einzulegen und die müden Beine zu schonen.
Ich lasse mich jedoch nicht beirren, gehe weiter und erreiche den Merianplatz. Da steht dann dieses Ding. Auf den ersten Blick erschließt sich sein Zweck nicht. Das Ding sieht aus wie ein – ja was? Ein Zylinder, ein Kolben, irgendwas aus einem Automotor, nur viel größer. Aber ich kenne mich nicht aus mit Automotoren. Beim Näherkommen erkennt man Wasser, das träge und lustlos die glatte, grafittiverzierte Edelstahlhaut hinabrinnt. Obendrauf hocken Tauben und nehmen ein Fußbad. Aha, ein Brunnen. Frankfurt ist kein guter Ort für Kunst im öffentlichen Raum. Neuerdings hat der Brunnen Gesellschaft bekommen, die moderne Ausführung einer Litfassäule, die den Brunnen um einiges überragt, wurde ihm zur Seite gestellt. Er scheint sich nun dahinter verschämt zu verstecken. Anwohner haben sich schon beschwert über den Werbeträger, er würde den Blick auf den Merianplatz behindern, dabei versteckt er nur dieses silberne Ding. Der den Platz dominierende, achteckeckige, flache Bau, der einst als öffentliches Badehaus diente, beherbergt jetzt ein Lokal, das Kupferstecher heißt und eine etwas edlere Umgebung bietet, was sich auch an den Preisen ablesen lässt. Dennoch bewegt sich alles noch im vertretbaren Bereich. Ein gastronomischer Betrieb wurde also durch einen anderen ersetzt, der übliche Lauf der Dinge auf der Berger Straße.Zwei öffentliche Duschräume stehen allerdings weiterhin zur Verfügung.
Auf zur Konsti
Weiter geht`s in Richtung Konstablerwache. Vor dem Schaufenster der Buchhandlung Ypsilon bleibe ich stehen und betrachte die Auslage. Ein paar Meter weiter, am Anlagenring schaue ich nach rechts zum ummauerten Bethmannpark mit seinem Chinesischen Garten. Der Pavillon dort fiel 2017 einem oder mehreren Brandstiftern zum Opfer. Dieses Schicksal teilt er mit vielen anderen Holzbauten der Stadt, darunter das wahre Wahrzeichen Frankfurts, der Goetheturm im Stadtwald. Der oder die Täter sind bis heute nicht gefasst. Das Gebäude wurde von chinesischen Fachleuten rekonstruiert und im November 2019 wieder eröffnet.
Ich gehe nach links zum Anlagenring, vorbei an einem Weiher, der diverse Wasservögel angelockt hat, und kreuze die Grünanlage. Radfahrer und Fußgänger kommen mir entgegen. Auf einer schattigen Bank sitzen Männer und Frauen mit Bierbüchsen in der Hand. Im Gerichtsviertel kurz vor der Zeil fällt ein heruntergekommenes Gebäude mit vergitterten Fenstern auf, das von einer bunt bepinselten hohen Mauer umgeben ist. Das Klapperfeld, ein ehemaliges Gestapo- und Polizeigefängnis, das seit einigen Jahren einem, natürlich umstrittenen, linksautonomen Zentrum Räume bietet. Die überaus sehenswerte Ausstellung zur Geschichte des Gefängnisses, die der Trägerverein des Klapperfeldes erarbeitet hat, kann samstags ab 15 Uhr besichtigt werden. Eintritt frei, Spende willkommen.
Gelegentlich wende ich mich auch nach rechts zur stark befahrenen Kurt-Schumacher-Straße, um über die kleine Große-Friedberger-Straße von Norden her zur Konstablerwache zu gelangen. Bei meinen Gängen vermeide ich es auf dem Hin-und Rückweg die selben Wege zu beschreiten, denn das mindert die Aufmerksamkeit. Und ist es nicht einer der schönsten Aspekte beim Gehen, Dinge zu entdecken, die anders dem Auge verborgen geblieben wären?
Wie gesagt, es ist Donnerstag, also Markttag. Bald habe ich das erste Ziel meines Spazierganges erreicht, den Erzeugermarkt auf der Konstablerwache. Noch ist genug Platz an den Ständen, erst ab 17 Uhr füllen sie sich mit Angestellten aus den umliegenden Bürohäusern, die hier ihren Feierabend einläuten. Ich esse eine Bio-Bratwurst aus der Rhön und trinke einen Schoppen. Derweil spuckt die Zeil fröhliche junge Menschen auf die Konstabler, die bepackt sind mit braunen Papiertaschen voller Billigklamotten. Auf der Kurt-Schumacher-Straße rauscht vierspurig der Verkehr vorbei. Unweit wurde auf dieser Straße im Sommer 2018 ein Radfahrer von einem LKW getötet. Dieser und einige andere Todesfälle von Radfahrern in Frankfurt sowie der unerwartet erfolgreiche Radentscheid, haben zu einem behutsamen Umdenken in der Frankfurter Verkehrspolitik geführt. Jetzt fallen die roten Radstreifen auf, die in jeder Richtung in einer akzeptablen Breite angelegt wurden. Die Autofahrer mussten dafür eine Spur abtreten. Diese Umverteilung der Verkehrsflächen muss dringend weitergehen.
Am Main
Gestärkt setze ich meinen Weg fort, es zieht mich an den Main. Am Römerberg, dieser Fotokulisse, wird geheiratet, musiziert, geschaustellert und salzgesäult. Von dort zieht es die Besucherschar weiter zur teilweise rekonstruierten Neuen Altstadt, einem Quartier, das hauptsächlich von Touristen aus der ganzen Welt bevölkert wird. Ich mache es wie die meisten Frankfurter, lasse die Altstadt links liegen und gehe statt dessen weiter in Richtung Eiserner Steg.
Dem neuen Historischen Museum, zwischen Römer und Main gelegen, ist ein anderes Schicksal als der Neuen Altstadt widerfahren. Aufgrund seiner sehr gelungenen Architektur, der interessanten und vielfältigen Ausstellungen wird es von den Frankfurtern angenommen. Dieses Museum ist ein Schmuckstück und eine Bereicherung für die Stadt, die an gelungener neuer Architektur nicht gerade allzu viel vorzuweisen hat.
Der Eiserne Steg trägt schwer an tausenden von sogenannten Liebesschlössern, diesem Unfug, der sich überall breitmacht und niemanden so erfreut wie die Schlosser-Innung. Würden sich all diese Liebesbeweise selbsttätig öffnen und in den Main versenken, wenn die ewige Liebe doch nicht so ewig war, dann wäre das Frankfurter Wahrzeichen weniger entstellt. Die Passanten scheint das nicht zu stören, es wird auf Teufel komm raus musiziert, fotografiert und geknutscht. Eine Zwanzigjährige nutzt den Aufzug, um sich das Treppensteigen zu ersparen.
Ich nehme die Treppe, bahne mir einen Weg durch die Menschenmenge und spaziere am Sachsenhäuser Ufer entlang in Richtung Maincafé. Zum Glück ist Donnerstag. An sonnigen Wochenenden ist das Mainufer bevölkert von tausenden Radlern, Joggern, Skatern, Spaziergängern und Hunden und ein Durchkommen wird fast unmöglich. An solchen Tagen gilt es den Uferweg zu meiden. Aber es ist Werktag und so finde ich einen Sitzplatz im Maincafé, diesem vielleicht schönsten Ort der Stadt. Ich trinke einen Kaffee und schaue der Skyline beim Wachsen zu. Jogger, Radfahrer und Spaziergänger kreuzen meinen Blick. Es ist noch nicht allzu lange her, dass das Mainufer von der Stadt wiederentdeckt und den Menschen zugänglich gemacht wurde. Über Jahrzehnte diente es vorwiegend als Parkplatz.
Diese neue Qualität ist natürlich auch Investoren nicht verborgen geblieben, die nun versuchen, für eine zahlungsfreudige Klientel am Mainufer Luxusimmobilien zu errichten. Östlich der Untermainbrücke, in zentraler Lage, fällt ein bunkerartiges, je nach Licht graues oder sandfarbenes Edelquartier auf, das von einem Sechzigmeterturm überragt wird. Völlig ironiefrei wurde das Ensemble auf Maintor getauft, obwohl es genau das Gegenteil dessen tut, was ein Tor gemeinhin macht, nämlich sich zu etwas zu öffnen. Das Maintor jedoch ist eine massive Barriere zwischen Fluss und Stadt. Die dort wohnenden „Kosmopoliten“ wird es nicht stören, solange es in der Tiefgarage einen Platz für den SUV gibt. Mit dem gemeinen Volk am Mainufer hat man eh nichts am Hut.
Dieses graue „Maintor“ liegt am Mainkai, jener zweispurigen Uferstraße, die Ende Juli 2019 „für den Rad- und Fußverkehr geöffnet“ wurde, sprich, für den Autoverkehr gesperrt. Für ein Jahr sollte getestet und Daten gesammelt werden, wie sich das auf den Verkehr in der Stadt auswirkt, für den Autoverkehr muss einschränkend gesagt werden. Abgesehen davon, dass die Maßnahme miserabel vorbereitet wurde, ist das natürlich eine gute Idee und kann nur ein erster Schritt sein auf dem Weg zu einer weitgehend autofreien Stadt. Aber es hat nicht gereicht, die Straße einfach nur mit Betonquadern zu sperren, und sonst aber alles sich selbst zu überlassen. Passanten und Radfahrende sind nach wie vor lieber direkt auf dem Uferweg am Main unterwegs. Der Mainkai blieb verwaist. Nur Räder und Elektroroller waren zu sehen. Auf dem gewonnenen Freiraum wurde nichts angeboten, keine Gastronomie, keine Bänke, keine Sitznischen, keine Bühnen für Klein- und Großkunst. Nichts was die Straße zu einem Boulevard gemacht hätte, auf dem man sich gerne aufhält.
Ausgeruht mache ich mich auf den Heimweg.
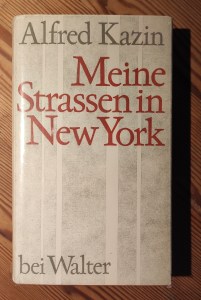
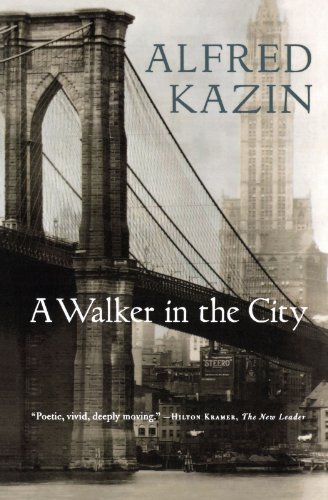
















































 Mein Verkehrsmittel ist das Fahrrad. In der Stadt ist es allen anderen Fahrzeugen überlegen. Es ist schnell, leise, preiswert und hält fit. Einen Stellplatz wird man in der Regel finden, auch wenn man gelegentlich etwas suchen muss. Kurz: Radfahren ist sozial und ökologisch verträglicher Individualverkehr in Reinkultur, ganz im Gegensatz zum Autofahren. Um so unbegreiflicher ist es, dass Städte immer noch viel zu wenig unternehmen, um das Radfahren in der Stadt attraktiver und sicherer zu machen. Aber immerhin sind einige zaghafte Versuche in diese Richtung zu bemerken, wenn sie auch bei Weitem nicht ausreichen. Diese unbefriedigende Situation sorgt dafür, dass Fahrradfahren in der Stadt eines nicht ist: entspannend. Im Gegenteil, Radfahrer sind in jeder Situation gefordert, den Überblick zu behalten. Kleine Unachtsamkeiten können schwerwiegende Folgen haben, bis hin zum Tod. Durch die Natur zu radeln ist hingegen ein Vergnügen sondergleichen.
Mein Verkehrsmittel ist das Fahrrad. In der Stadt ist es allen anderen Fahrzeugen überlegen. Es ist schnell, leise, preiswert und hält fit. Einen Stellplatz wird man in der Regel finden, auch wenn man gelegentlich etwas suchen muss. Kurz: Radfahren ist sozial und ökologisch verträglicher Individualverkehr in Reinkultur, ganz im Gegensatz zum Autofahren. Um so unbegreiflicher ist es, dass Städte immer noch viel zu wenig unternehmen, um das Radfahren in der Stadt attraktiver und sicherer zu machen. Aber immerhin sind einige zaghafte Versuche in diese Richtung zu bemerken, wenn sie auch bei Weitem nicht ausreichen. Diese unbefriedigende Situation sorgt dafür, dass Fahrradfahren in der Stadt eines nicht ist: entspannend. Im Gegenteil, Radfahrer sind in jeder Situation gefordert, den Überblick zu behalten. Kleine Unachtsamkeiten können schwerwiegende Folgen haben, bis hin zum Tod. Durch die Natur zu radeln ist hingegen ein Vergnügen sondergleichen.














